Walther Flemming
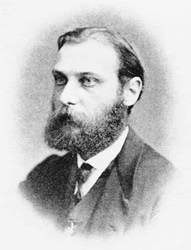


Die originale Bildunterschrift lautet: Einige aus vielen gesehenen Theilungen aus der menschlichen Cornea. Es handelt sich möglicherweise um die erste publizierte Darstellung menschlicher Chromosomen.

Walther Flemming, auch Walter Flemming (* 21. April 1843 in Sachsenberg bei Schwerin; † 4. August 1905 in Kiel) war ein deutscher Anatom und Zellbiologe. Er gilt als der Begründer der Zytogenetik. Von ihm wurden 1879 die Begriffe Chromatin und Mitose geprägt.
Leben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Walther Flemming wurde auf dem Sachsenberg, einer damals noch nicht zum Stadtgebiet von Schwerin gehörigen Heilanstalt, als fünftes Kind des dort wirkenden Psychiaters Carl Friedrich Flemming (1799–1880) und dessen zweiter Frau Auguste, geb. Winter, geboren. Er besuchte das Gymnasium Fridericianum Schwerin (damals die Residenz der Großherzöge von Mecklenburg-Schwerin), wo er Ostern 1862 das Abitur bestand. Auf dem Gymnasium machte er die Bekanntschaft mit Heinrich Seidel, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband.[1] Flemming studierte in Göttingen, Tübingen, Berlin und an der Universität Rostock Medizin,[2] wo er 1868 das Staatsexamen ablegte. In Tübingen wurde er Mitglied der Burschenschaft Germania Tübingen.[3] Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 diente er als Militärarzt. 1873 bis 1876 arbeitete er als Dozent an der (damals noch deutschsprachigen) Karl-Ferdinands-Universität in Prag. Nach einer erfolglosen Bewerbung um einen Lehrstuhl an der Universität Königsberg wurde er 1876 auf eine Professur für Anatomie an die Universität Kiel berufen, wo er als Direktor des dortigen Anatomischen Institutes bis zu seinem Tod wirkte. Im Jahr 1879 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt.[4] An der Kieler Universität hatte Flemming, der von seinen Zeitgenossen als konfliktscheue und friedliebende Persönlichkeit beschrieben wurde und aufgrund seiner Milde und seines Wohlwollens bei seinen Studenten beliebt war, etliche Kämpfe mit der Universitätsverwaltung aufgrund der ungenügenden finanziellen und personellen Ausstattung des anatomischen Instituts auszufechten, was auf die Dauer seine Gesundheit untergrub. Er entwickelte eine nicht näher umschriebene neurologische Erkrankung, die ihn schließlich zur vorzeitigen Amtsaufgabe zwang. Er starb im Alter von 62 Jahren in Kiel.
Werk
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flemming war einer der Pioniere der mikroskopischen Zytologie. Unter Verwendung der neu verfügbaren industriell hergestellten Anilinfarben fand er eine Zellstruktur, die sich stark mit basophilen Farbstoffen anfärben ließ und die er deswegen Chromatin (von altgriechisch χρῶμα, chroma = Farbe) benannte. Er entdeckte, dass das Chromatin mit fadenähnlichen Strukturen, den Chromosomen (d. h. „Farbkörperchen“) assoziiert war (dieser Name wurde 1888 von Heinrich Wilhelm Waldeyer geprägt). Etwa zur selben Zeit und unabhängig von Flemming machte der belgische Wissenschaftler Édouard van Beneden ähnliche Beobachtungen. Flemming untersuchte den Prozess der Zellteilung und Teilung des Chromatins, für den er den Begriff Mitose prägte.[5] Seine Ergebnisse veröffentlichte er 1882 in dem bahnbrechenden Werk Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung. Aufgrund seiner Entdeckungen formulierte Flemming den Grundsatz omnis nucleus e nucleo (deutsch: Jeder Zellkern entsteht aus einem Zellkern), in Analogie zu Virchows omnis cellula e cellula (deutsch: Jede Zelle entsteht aus einer Zelle).
Die Arbeiten Gregor Mendels über Vererbung waren Flemming nicht bekannt, so dass er nicht zu der Vermutung kam, dass es sich bei den Chromosomen um die Erbsubstanz handeln könnte. Erst ein halbes Jahrhundert später wurde mit den Experimenten von Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod und Maclyn McCarty bewiesen, dass die in den Chromosomen verpackte DNA tatsächlich die Erbsubstanz darstellt. Nichtsdestoweniger werden Flemmings Arbeiten (zusammen mit denen von August Weismann, Matthias Jacob Schleiden, Theodor Schwann, Thomas Hunt Morgan u. a.) zu den bedeutendsten der modernen Zellbiologie gezählt.[6][7]
Die Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie verleiht seit dem Jahre 2004 die Walther-Flemming-Medaille.
Schriften (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Beobachtungen über die Beschaffenheit des Zellkerns. In: Archiv für mikroskopische Anatomie. Band 13, 1877, S. 693–717.
- Beiträge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen. In: Archiv für mikroskopische Anatomie. Band 16, 1879, S. 302–436, Band 18, 1880, S. 151–259, und Band 20, 1881, S. 1–86.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- D. Lukács: Walter Flemming, discoverer of chromatin and mitotic cell division. In: Orvosi hetilap. 122, 6, 1981, S. 349–350 (ungarisch) PMID 7015236.
- Nicolà Latronico: Heredity, constitution and diathesis. In: Minerva Pediatr. 52 (1–2), S. 81–115, PMID 10829597.
- C. S. Breathnach: Biographical sketches No. 18 – Flemming. In: Irish medical journal. 75, 6, 1982, S. 177, PMID 7050007.
- N. Paweletz: Walther Flemming: pioneer of mitosis research. In: Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2, 1, 2001, S. 72–75, PMID 11413469.
- W. Flemming: Beiträge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen. In: Arch. Mikroskop. Anat. 16, 1878, S. 302–436 und 18, 1880, S. 151–289. Neuabdruck in englischer Übersetzung in: J. Cell Biol. 25, 2007, S. 3–69 (PDF).
- E. A. Carlson: The Analysis of Mitosis Shifts Attention to the Chromosomes. In: Mendel's Legacy. The Origins of Classical Genetics. CSHL Press, 2004, ISBN 0-87969-675-3, S. 24–25.
- P. A. Hardy, H. Zacharias: Walther Flemming und die Mitose: Der Beitrag seiner ersten Kieler Jahre. In: Schr. Naturwiss. Ver. Schlesw.-Holst. 70, 2008, S. 3–15 (Online, PDF-Datei; 624 kB)
- Georg Uschmann: Flemming, Walther. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 241 f. (Digitalisat).
- Edith Fleiner: Flemming, Walther. In: Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon. Band 4. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1976, S. 72f.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur von und über Walther Flemming im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Literatur über Walther Flemming in der Landesbibliographie MV
- Flemmings Hauptwerk: Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung, 1882; Originaltext als pdf
- W. Flemming Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungs-Erscheinungen. In: Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. 3, 1878, S. 23–27 (Reprint; PDF; 129 kB)
- Walter Flemming Medaille (PDF-Datei; 190 kB)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Jürgen Seidel: Der Schriftsteller Heinrich Seidel und sein berühmter Jugendfreund – Walther Flemming ( vom 1. Oktober 2008 im Internet Archive). In: Zellbiologie aktuell, 30. Jahrgang, Ausgabe 2/2004, S. 26 f. (PDF 317 kB)
- ↑ Siehe dazu den Eintrag der Immatrikulation von Walther Flemming im Rostocker Matrikelportal
- ↑ K. Philipp: Burschenschaft Germania Tübingen, Gesamtverzeichnis der Mitglieder seit der Gründung 12. Dezember 1816. Stuttgart 2008.
- ↑ Mitgliedseintrag von Walther Flemming bei der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, abgerufen am 28. Juni 2022.
- ↑ Die später von ihm Mitose genannten Vorgänge stellte er erstmals 1878 der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vor: Flemming, W. Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungs-Erscheinungen. In: Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein 3 (1878), 23-27. ( des vom 10. April 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 1,4 MB)
- ↑ 100 Greatest Discoveries – Carnegie Institution ( vom 1. Oktober 2009 im Internet Archive)
- ↑ The Science Channel: 100 Greatest Discoveries: Biology ( vom 22. November 2012 im Internet Archive)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Flemming, Walther |
| ALTERNATIVNAMEN | Flemming, Walter |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Anatom und Zellbiologe |
| GEBURTSDATUM | 21. April 1843 |
| GEBURTSORT | Sachsenberg bei Schwerin |
| STERBEDATUM | 4. August 1905 |
| STERBEORT | Kiel |